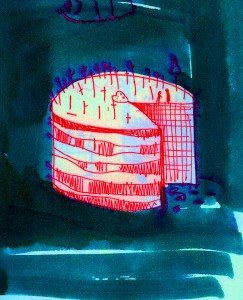Sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen alle gut, wie pessimistisch die Polen sich über die „Solidarność” äußern. Aber wissen wir auch, wie Ausländer über sie sprechen, insbesondere die Deutschen, die – was sowohl Polen als auch Deutsche oft vergessen – die „Solidarność” in den Jahren 1980-1982 umfassend unterstützt haben? Die Begeisterung über „S“ existiert noch heute – das beweist der Text von Karl-Heinz Nusser, dessen Essay über den polnischen August als immer noch aktuelles Vorbild einer bürgerlichen Bewegung für Westeuropa den Ausgangspunkt für das Thema dieser Woche bildet. Mit Karl-Heinz Nusser polemisiert Krzysztof Ruchniewicz, der an den von Jadwiga Staniszkis geprägten Begriff „sich selbst beschränkende Revolution“ erinnert, Robert Brier, der die „Solidarność” als Vorbild nicht für eine bürgerliche, sondern eine „antiutopische“ Bewegung interpretiert, und Agnes Arndt, die feststellt, dass die „Solidarność” kein Vorbild für Westeuropa war, allerdings der Dialog über sie zu einer Annäherung zwischen dem Osten und dem Westen Europas führte. Jutta Wiedmann beschreibt im Weiteren das Phänomen der „Polenhilfe“, der deutschen Unterstützung für unser Land in den Jahren 1980-1982, indem sie fragt, ob dieses westdeutsche bürgerliche Engagement die These Karl-Heinz Nussers stützt. Łukasz Jasina versucht sich am negativen, diffusen Bild der „Solidarność” in der polnischen öffentlichen Debatte und vergleicht es mit der Deutung aus dem ersten Text dieses Themas der Woche. Jarosław Kuisz macht schließlich Vorschläge für die Zukunft. „Die Polen sollten, ebenso wie die Briten über ihre Königin, lernen über »Solidarność« zu lachen“ – schreibt er.
Lesen Sie selbst!
Die Redaktion
1. KARL-HEINZ NUSSER: Die Wiederbelebung des Bürgerideals: der osteuropäische Ursprung
2. KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ: Ein gemeinsames Europa der Bürger? Anmerkungen zum Text von Karl-Heinz Nusser
3. ROBERT BRIER: Die Bürgergesellschaft und das Ende der Utopien. Zum ideenhistorischen Erbe der „Solidarność“
4. AGNES ARNDT: Inspiration oder Irritation? Zivilgesellschaft in Polen und Europa
5. JUTTA WIEDMANN: Die Deutschen und die sogenannte Polenhilfe 1980-1983
6. ŁUKASZ JASINA: Feierlichkeiten, Rückblicke und sonst (fast) nichts
7. JAROSŁAW KUISZ: Solidarność. Die Suche
Wersja polska/polnische Version
* * *
Die Wiederbelebung des Bürgerideals: der osteuropäische Ursprung
Wenn es in den gegenwärtigen westlichen demokratischen Gesellschaften um bürgerschaftliches Engagement von Unternehmen oder von Bürgern geht, wenn von Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen, Bürgerstiftungen und staatlicher Kooperation mit Freiwilligenagenturen oder Ähnlichem gesprochen wird, dann haben all diese Phänomene mit einem Impuls der östlichen Bürgerrechtsbewegungen durch deren gelungene Niederringung der totalitären Parteidiktaturen zu tun. Die Bürgerrechtsbewegungen der jeweiligen Länder – vor allem: Polen, Tschechoslowakei, Ungarn und die DDR – demonstrierten vor aller Welt die revolutionäre Kraft der Ursprungsideen der Demokratie. Die Initialzündung und Ermutigung für alle Bürgerrechtsbewegungen Mitteleuropas waren jedoch der Generalstreik der Arbeitenden auf der Leninwerft in Gdansk und die darauf folgenden Vereinbarungen zwischen der „Solidarność“ und der kommunistischen Regierung Polens, die in Zugeständnissen der Regierung bestanden.
Wenn die Demokratie viele Seiten hat und vieles erfordert, so besteht ihr Kern doch in der Annahme von freien und gleichen Bürgern, die das Recht auf politische Mitgestaltung des Gemeinwesens haben. Die Geschehnisse in Mitteleuropa haben die westlichen Demokratien Europas und die USA dahingehend inspiriert, eingefahrene Gleise zu verlassen und neue Wege auszuprobieren. Vor allem haben sie viele teilnehmende Beobachter daran erinnert, dass den Bürgerrechten auf Freiheit und Leben auch Bürgerpflichten entsprechen. In diesem Sinne haben die genannten Ereignisse das Verständnis des Begriffs des Bürgers erneuert und vitalisiert. Die moderne Demokratie kann dabei an große Traditionen anknüpfen. Bereits in den griechischen antiken Stadtstaaten spielte der Bürger eine wichtige Rolle. In der politischen Theorie des Aristoteles ist Bürger derjenige, der an politischen Ämtern und Ehren teilhat. Bei einer guten Staatsform realisieren nach der Auffassung des Aristoteles die Bürger das gemeinsame Wohl und nicht die Herrschenden ihren eigenen Vorteil. Seitdem es in der Moderne Demokratien gibt, die sich aus freien und gleichen Bürgern zusammensetzen und in denen das Volk der Souverän ist, ist der Bürger nicht mehr der Untertan einer Obrigkeit, sondern ein in bestimmter Weise an der Regierung und an dem Wohl des Gemeinwesens Beteiligter. Transferiert auf moderne Bedingungen der Demokratie bedeutet Bürgertugend nach Aristoteles bestimmte Weisen der politischen Beteiligung der Bürger, über das Gemeinwohl mit zu beratschlagen und das öffentliche Leben mit zu gestalten.
Nicht alle sehen den inneren Zusammenhang von Bürgertugend und lebendiger politischer Freiheit in der Demokratie. Thomas Hobbes z. B. hatte argumentiert, dass die Souveränität des Staates das Wichtigste sei, gleichviel ob nun ein Einzelner oder ein repräsentatives Parlament den Staat regiere. Zu dieser Auffassung treten in der Moderne extrem liberale Positionen hinzu. Nach diesen erfreut sich der Staatsbürger der bürgerlichen und politischen Grundfreiheiten, um auf dem freien Markt seinen Profit erwirtschaften zu können. Es komme darauf an, die unterschiedlichen Begabungen und Kräfte der Menschen sich entfalten zu lassen. Nach einem Wort des zeitgenössischen extrem liberalen Ökonomen Milton Friedmann besteht die Gemeinwohlverpflichtung eines Unternehmens ausschließlich im Profit und in dessen Maximierung. Aus der Sicht der Befürworter der Bürgertugend wäre das Ziel des Profites keineswegs zu verneinen, sehr wohl aber zu ergänzen. Die Erlangung des Eigenwohls versetzt das Unternehmen in die Lage, zum Gemeinwohl beizutragen. Trägt das Unternehmen in dieser Weise zum Gemeinwohl bei, dann gibt es nach beiden Seiten positive Effekte. Es hilft Zwecken, die allen zugutekommen, und es hilft den Unternehmen; denn diese zum Ideal von „good governance“ erhobene moralische Einstellung steigert das Ansehen und den Rückhalt des Unternehmens bei entsprechenden Käuferschichten und in der Bevölkerung, eine Rückwirkung, die dem Unternehmen wiederum zugute – kommt.
* Karl-Heinz Nusser ist Philosoph, apl. Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
* * *
Ein gemeinsames Europa der Bürger? Anmerkungen zum Text von Karl-Heinz Nusser
Der Umbruch von 1989 war für Europa zweifellos von außerordentlicher Bedeutung. Zeitgleich mit dem Niedergang der kommunistischen Staaten in Mittel- und Osteuropa begann der schwierige Transformationsprozess der ehemaligen „Volksdemokratien“ sowie die Integration zweier nach 1945 voneinander getrennter Teile des Alten Kontinents. Dieser Prozess wird Jahre dauern, aber bereits heute können wir sehr interessante Tendenzen beobachten, die – wenn sie entsprechend bekannt gemacht werden – auch im Westen zu Diskussionen anregen könnten. Eine davon ist die Zunahme des Wissens im Westen über die Ereignisse im „hinter dem Eisernen Vorhang“ liegenden Teil Europas. Nach 1945 wurde dieser Teil Europas vom Westen klischeehaft als Teil des sowjetischen Imperiums wahrgenommen und Versuche der ihm untergeordneten Staaten, die Unabhängigkeit zu erreichen, wurden meist als interne Angelegenheit des Ostblocks behandelt. Die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges mit Millionen von Toten und Kriegsversehrten sowie riesigen materiellen Verlusten wurden zum Gründungsmythos der europäischen Integration, die zu Beginn der 1950er Jahre zunächst von sechs Staaten angestoßen wurde. Nicht weniger stark war der antikommunistische Mythos: Die Bedrohung seitens der UdSSR und des Ostblocks vereinte die Westeuropäer auch politisch, wozu auch der Schutzschirm der USA beitrug.
Vor dem Hintergrund dieser Ausgangsbedingungen kann man die Politik der USA und einiger westeuropäischer Staaten wie der Bundesrepublik (Neue Ostpolitik) in den 1960er Jahren erörtern, die laut den Grundsätzen der Entspannungspolitik Kontakte zu den kommunistischen Regimen suchten und mit diesen auch wirtschaftlichen Austausch betrieben. Zweifellos ein großer Erfolg dieser Politik war 1975 in Helsinki die Unterzeichnung von Vereinbarungen, die auch die kommunistischen Staaten zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtete.
Die Entstehung der „Solidarność“ in Polen war – obwohl es sich um eine deutliche Demonstration bürgerlicher Emanzipation handelte – zumindest für einige Länder des Westens in gewissem Sinne heikel. Denn sie konnte die Beziehungen zur UdSSR verkomplizieren. Allerdings war es schwierig zu ignorieren, dass zum ersten Mal in einem Ostblockstaat eine riesige bürgerliche Massenbewegung entstanden war, die von unten aus der Gesellschaft geschaffen worden war und die spontan nach demokratischen Grundsätzen handelte. Natürlich gab es zuvor bereits Versuche, die Vorherrschaft Moskaus und die kommunistische Diktatur abzuschütteln, jedoch nie nahm daran nahezu die gesamte Gesellschaft teil, sondern immer nur einige ihrer Gruppen. Auch das Bewusstsein über das Eingreifen der Roten Armee in Ungarn (1956) und in der Tschechoslowakei (1968) bremste die Bereitschaft zu mutigeren Vorstößen. Die Situation in Polen und in der UdSSR war hingegen 1980 schon eine andere. Aus dem Streik in einer Werft sprang der Funke schnell auf andere Betriebe und von dort auf ganz Polen über. Den Arbeitern – der vermeintlichen Avantgarde des kommunistischen Systems – schlossen sich schnell andere gesellschaftliche Gruppen wie Bauern und Intellektuelle an. Die Solidarność-Bewegung wurde innerhalb kurzer Zeit eine gesellschaftsübergreifende und das gesamte Land erfassende Bewegung, die nicht nur in den großen Städten und den Industriezentren tätig wurde, sondern auch in den kleineren Zentren der Landkreise und in ländlichen Regionen.
Es handelte sich jedoch um eine sich selbst beschränkende Revolution. Ihr Ziel war es nicht – wie schon häufig betont wurde – das bestehende System abzuschaffen, sondern die Rechte der Arbeiter (freie Gewerkschaften, Streikrecht) geltend zu machen, und damit die Einhaltung von in der Verfassung theoretisch gewährten Rechten und Freiheiten zu erreichen. Die Streikenden waren Realisten und standen mit beiden Beinen fest auf der Erde. Sie wussten genau, dass jede – beispielsweise eine Unsicherheit auslösende – politische Forderung in diese Richtung eine Reaktion der polnischen Machthaber und der UdSSR sowie ihrer Verbündeten hervorrufen konnte. Wie vorsichtig und wohl überlegt dieses Vorgehen war, erkennen wir heute, seitdem wir die Diskussionen innerhalb der Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes kennen und wissen, dass dort schon im Dezember 1980 eine Intervention in Polen und eine Eliminierung des „Bazillus“ namens „Solidarność“ gefordert wurde. Die Arbeiter der Küstenregion und die ganze Gesellschaft erfasste folglich in diesen revolutionären Monaten die Erkenntnis, dass sie über die Stärke verfügten, jene Änderungen einzuleiten, die die Kommunisten sich so hochtrabend auf die Fahne geschrieben hatten. Die Ausrufung des Kriegsrechts bedeutete das Ende für die offizielle Tätigkeit der Gewerkschaft. Ein Symbol bleibt der Priester Jerzy Popiełuszko, der von Funktionären des Sicherheitsdienstes ermordet wurde. Für einen Moment fürchtete sich der kommunistische Staat vor Massenprotesten, sodass – und dies war erneut ein besonderes Phänomen – ein öffentlicher Prozess und die Verurteilung der Schuldigen erlaubt wurde.
Die Reaktionen auf die Entstehung der „Solidarność“ und die ersten Monate ihres Bestehens fielen im Westen Europas unterschiedlich aus: Sie reichten von Unterstützungsgesten bis zur Verurteilung. Einige dieser Staaten sahen in den streikenden Arbeitern an der Küste eine weitere Bedrohung für den brüchigen Frieden in Europa, eine unnötige „Reizung“ der UdSSR. Für die von der UdSSR beherrschten Staaten stellte die „Solidarność“ eine große Bedrohung dar, da sie die Entstehung ähnlicher Bewegungen in ihren Ländern fürchteten. Noch im Oktober 1980 schloss die DDR ihre Grenze zu Polen und berief alle ihre Studenten aus unserem Land ab.
Die Umwälzungen von 1989 ermöglichen es also den Westeuropäern, Mittel- und Osteuropa neu zu „entdecken” und dessen Erfahrungen besser kennenzulernen. In diesem Zusammenhang habe ich den Text von Karl-Heinz Nusser gelesen und freue mich darüber, dass er das polnische Beispiel von vor Jahren als etwas darstellt, das zu einer tiefer gehenden Diskussion über den Zustand des heutigen Europa inspirieren kann. Denn zum ersten Mal haben wir die Chance gemeinsam zu diskutieren und gemeinsame Antworten zu suchen. Polen tritt auch zum ersten Mal als gleichberechtigter Partner auf. Die banale Wahrheit: Nicht die Staaten formen Europa, sondern seine Bürger, ist die Quintessenz der Ausführungen Nussers. Welches Europa brauchen die Europäer heute? Wie sieht der Beitrag jedes Einzelnen von ihnen zu allgemeinen europäischen Fragen aus? Welche Verpflichtungen haben die Bürger und welche hat der Staat? Die „Solidarność“ hat gezeigt, wie man mit Mut und mit Kompromissen ein Ziel erreichen kann. Dies geschah aber in einer Phase des außerordentlichen Gefühls der Einigkeit und des Engagements. Auch die Frage, was für uns selbst aus dem Erbe der „Solidarność“ folgt, scheint berechtigt. Wenn wir die damalige bürgerliche Geisteshaltung rühmen, müssen wir ständig daran erinnern, wie schwach unsere Zivilgesellschaft noch ist, wie wenig Polen im Grunde aktiv an der Demokratie teilnehmen, unabhängig davon, ob dies die lokale, nationale oder europäische Ebene betrifft. Aber bessere Voraussetzungen für verantwortungsvolle, bürgerliche Überzeugungen als im Moment gibt es nicht. Die 21 Forderungen aus Danzig sind ein Symbol für gewisse Haltungen und Bestrebungen, aber natürlich kein politisches Programm für das gegenwärtige Europa. Es ist allerdings gut, die Europäer – für deren Mehrheit die Demokratie selbstverständlich, wenn nicht sogar langweilig ist – daran zu erinnern, dass vor nicht allzu langer Zeit ein großer Teil unseres Kontinents nur in der direkten Auseinandersetzung mit den Machthabern seinen Standpunkt artikulieren konnte und nur unter großen Schwierigkeiten die Achtung grundlegender Menschen- und Bürgerrechte erlangen konnte. Vielleicht regt der Text von Karl-Heinz Nusser zu einer vertieften Debatte über den Zustand Europas und das vielschichtige Erbe der Europäer an.
* Krzysztof Ruchniewicz ist Historiker, Direktor des Willy Brandt Zentrums an der Universität Wroclaw.
* Übersetzung aus dem Polnischen: Jutta Wiedmann
* * *
Die Bürgergesellschaft und das Ende der Utopien. Zum ideenhistorischen Erbe der „Solidarność“
Ist die „Solidarność“ ein Vorbild für zivilgesellschaftliches Engagement in Westeuropa? Als konkrete historische Bewegung ist sie das sicher nicht. Dazu bleibt das westliche Wissen über gesamteuropäische Geschichte zu fragmentarisch und dazu bleiben insbesondere viele Deutsche zu stark der unbewussten, aber dafür umso wirksameren Idee eines west-östlichen Kulturgefälles verhaftet. Freilich lassen auch die Entwicklungen in Polen selbst die „Solidarność“ nicht unbedingt als Vorbild erscheinen: Die jüngsten Ereignisse um die Vereidigung von Bronisław Komorowski und um das Kreuz vor dem Präsidentenpalast zeigen, dass der seit 1990 von den Erben der „Solidarność“ ausgetragene „Krieg an der Spitze“ andauert. Damit soll nicht gesagt werden, dass die „Solidarność“ nicht durchaus eine erhebliche geistes- und ideengeschichtliche Bedeutung hatte; diese scheint jedoch eher indirekt gewesen zu sein.
Im Jahr 1987 argumentierte Adam Michnik, dass der wichtigste Beitrag der „Solidarność“ zur europäischen Kultur ihr Charakter als antiutopische Bewegung sei. Ausgangspunkt des polnischen Sommers war kein revolutionärer Umsturz; mit der Forderung nach einer unabhängigen Gewerkschaft verlangte man von den Mächtigen vielmehr nur das, was zu garantieren sie sowieso vorgaben. Dieses Ziel wurde durch gewaltfreie Methoden auf dem Weg einer Übereinkunft mit den Regierenden erreicht. Bewusst oder unbewusst setzten die streikenden Arbeiter damit das Konzept eines evolutionären Wandels um, dessen Triebfeder das Engagement verantwortungsbewusster Bürger war, die versuchten ihre Rechte über den Weg der Selbstorganisation schrittweise, durch das Erreichen mittel- und kurzfristiger Ziele durchzusetzen. Ziel dieses Wandlungsprozesses sollte nicht die Verwirklichung einer ideologischen Blaupause sein, sondern die Ermöglichung einer auf Wahrheit und Menschenwürde gründenden sozialen Normalität.
Es ist bezeichnend, dass Michnik auf diesen antiutopischen Charakter der „Solidarność“ in einem Gespräch mit Daniel Cohn-Bendit hinwies. Lange nachdem Michnik die Wende vom „marxistischen Dissidenten zum antitotalitären Oppositionellen“ vollzogen hatte, blieb die westliche Neue Linke nämlich einem Denken in Utopien und der Suche nach einer Alternative zum westlichen Gesellschaftsmodell verhaftet. Auch wenn der Realsozialismus Anfang der Achtzigerjahre längst aufgehört hatte, Projektionsfläche für westliche Sehnsüchte nach einem fortschrittlicheren Gesellschaftsmodell zu sein, so war es doch bedeutend, dass er sich gegen den Antiutopismus der „Solidarność“ letztlich nur mithilfe von Panzern zu Wehr zu setzen wusste. Gerade unter Frankreichs „zweiter Linker“ (deuxième gauche), aber auch unter den westdeutschen Grünen scheint die Begegnung mit der ostmitteleuropäischen Opposition daher zu einem Prozess beigetragen zu haben, an deren Ende das westliche Gesellschaftsmodell nicht mehr durch ein utopisches Projekt ersetzt, sondern durch zivilgesellschaftliches Engagement ergänzt werden sollte. Hier liegt die ideengeschichtliche Bedeutung von Dissens und Opposition in Ostmitteleuropa.
Dabei ist anzumerken, dass dieser Ideentransfer kein einseitiger Prozess war: Wie Agnes Arndt gezeigt hat, tauchte der Begriff der Zivilgesellschaft im Vokabular führender polnischer Intellektueller lange Zeit nicht auf. Auch die Oppositionsbewegungen Ostmitteleuropas scheinen bis zu einem gewissen Grad eine Projektionsfläche westlicher Wunschvorstellungen gewesen zu sein und es stellt sich die Frage, inwieweit westliche Wahrnehmungen mit den Ereignissen in Polen selbst übereinstimmten.
Es gibt einen Punkt, der in den Transfers zwischen Ost und West verloren gegangen zu sein scheint, der mir für die gegenwärtige Debatte um die Bürgergesellschaft äußerst wichtig erscheint. Die Bedeutung von Kirche und Religion für die „Solidarność“ wird oft in polnischen Spezifika gesehen. An dieser Beobachtung ist sicher vieles wahr; wahr ist auch, dass sich die polnische Kirche gelinde gesagt schwer tat und tut, ihren Platz in der nachkommunistischen Ordnung zu finden. Wenn sich jedoch auch Linksintellektuelle wie Adam Michnik, Jacek Kuroń oder Leszek Kołakowski in ihrer Abkehr von der „säkularen Religion“ des Marxismus-Leninismus authentisch religiösen Werten und Ideen zuwandten, äußert sich darin meines Erachtens die Erkenntnis, dass gerade die antiutopische Bürgergesellschaft in ein transzendentes Wertesystem eingebettet werden muss, das die Achtung individueller Würde menschlicher Willkür entzieht und politisches Handeln zur Ausrichtung auf das Gemeinwohl verpflichtet. In einer Zeit, in der politische Theorie und öffentlicher Diskurs oszillieren zwischen dem Modell vom Bürger als homo oeconomicus und den auf die Einforderung partikularer Rechte ausgerichteten „identity politics“, erscheint mir dies ein höchst bedeutsames Erbe der „Solidarność“ für die Gegenwart zu sein.
* Robert Brier ist Historiker und Politikwissenschaftler. Er arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau.
* * *
Inspiration oder Irritation? Zivilgesellschaft in Polen und Europa
Zu einem festen Bestandteil der jüngsten Forschung über Zivilgesellschaft gehört die – unter anderem auch von Karl-Heinz Nusser geäußerte – Vermutung, es handele sich um einen bis auf die Antike zurückweisenden Begriff, der seine eigentliche Bedeutung für die zeitgenössische Diskussion jedoch erst im Zuge der friedlichen Revolutionen in Ostmitteleuropa erfahren habe. Dieser so genannten „Renaissance“ sei es zu verdanken, dass Zivilgesellschaft in den vergangenen 15 Jahren wieder zu einem Grundbegriff der politischen und wissenschaftlichen Terminologie in Europa und den USA avancierte. Weniger bekannt hingegen ist die Tatsache, dass die Wiederentdeckung des Begriffes nicht in Osteuropa allein erfolgte, sondern vielmehr als Produkt einer transnationalen Verflechtung divergierender Akteure, Aktions- und Interessenfelder in Ost- wie Westeuropa begriffen werden müsste.
So ging es den Regimekritikern in Polen um einen evolutionären Weg der partiellen Demokratisierung des öffentlichen Lebens, der sich von der Theorie des Totalitarismus abstieß, an der Idee der Demokratie orientierte und die Reform des Sozialismus fokussierte. Zwischen einem westlich geprägten Demokratieverständnis mit freier Marktwirtschaft und einem von seinen totalitären Zügen befreiten Sozialismus sollte ein »Dritter Weg« gefunden und ein neues Verhältnis der Gesellschaft zum Staat geebnet werden. Dieser in Teilen immer noch einem sozialistischen Gedankengut verpflichteten Gesellschaftsutopie verdankte eine ideologisch und politisch äußerst heterogene Gruppe von Arbeitern und Intellektuellen eine normative, aber auch organisatorische Ausgangsbasis, die das oppositionelle Milieu in Polen jenseits einer Dichotomie von „wir“ und „sie“, von links und rechts, von laizistisch und katholisch erstmalig bündelte und formierte. Der polnische Begriff der Gesellschaft wurde dabei sukzessive aus dem offiziellen Sprachgebrauch des sozialistischen Regimes losgelöst und um eine neue, auf die politische Dimension freier, mit Grundrechten und -freiheiten ausgestatteter Individuen verweisende Bedeutungsschicht aufgewertet. An ein klassisches Narrativ der polnischen Nationalgeschichte und an die Vorstellung eines negativ konnotierten, von außen oktroyierten Staates anknüpfend, bereiteten diese Ideen das vor, was von westlichen Beobachtern in den ausgehenden 1980er Jahren als eine „Renaissance der Zivilgesellschaft“ wiederentdeckt wurde. Begrifflich und konzeptionell handelte es sich jedoch um ein Phänomen, das mit der westlichen Tradition einer zwischen dem Staat, der Wirtschaft und der Privatsphäre vermittelnden Instanz zunächst wenig gemeinsam hatte. Zivilgesellschaft in Polen zwischen 1968 und 1989, das war vor allem ein dezidiert antistaatliches Unternehmen, ein in spontanen und oft mit hohen persönlichen Kosten verbundener Versuch des Widerstands gegen den Staat und der Loslösung gesellschaftlicher Autonomiebereiche aus diesem Staatswesen, das moralisch und politisch abgelehnt und doch unter geopolitischen Gesichtspunkten gezwungenermaßen akzeptiert wurde.
Erst im Zuge einer verstärkten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Systemwechsel in Ostmitteleuropa begannen die Akteure des Transformationsprozesses in Polen, diesen Prozess mit dem gleichen Wortlaut zu benennen wie ihre Gesprächspartner aus Westeuropa. Der Begriff der Zivilgesellschaft diente auf diese Weise nicht nur den polnischen, sondern auch den Beobachtern aus Westeuropa und den Vereinigten Staaten als Fluchtpunkt einer neuen Sichtweise auf die Möglichkeiten gesellschaftlichen Engagements und als sprachlicher Anknüpfungspunkt zur Vermittlung der darin gesammelten, höchst unterschiedlichen Erfahrungen auf beiden Seiten des mittlerweile gefallenen Eisernen Vorhangs. Zwei Lebenswelten, deren wichtigstes Distinktionsmerkmal bis 1989 ihr demokratisches beziehungsweise autoritäres Regierungssystem war, trafen hier aus Faszination für ein Phänomen und einen Begriff zusammen. Dass es gerade dem Teil Europas, in dem die politischen Betätigungsmöglichkeiten seiner Bürger und Gesellschaften über Jahrzehnte hinweg eklatant eingeschränkt worden waren, gelungen war, eine zivilgesellschaftliche Organisation mit der politischen Sprengkraft der zehn Millionen Bürger umfassenden „Solidarność“ hervorzubringen, war sicherlich einer der ausschlaggebenden Gründe für das steigende Interesse westeuropäischer Intellektueller an den Strategien der polnischen Opposition und am Begriff und Phänomen der Zivilgesellschaft. Gesellschaftliches Engagement in Polen hatte eine Intensität erreicht, die auch von denjenigen westeuropäischen Intellektuellen, die sich seit Jahren wissenschaftlich oder in ihrem politischen Engagement mit dem Phänomen der Bürger- oder Zivilgesellschaft befassten, nicht ohne Weiteres zu erklären war. Vor allem aber handelte es sich um ein Phänomen, das den Blick auf die eigene Lebenswirklichkeit veränderte, das die politischen, ökonomischen und sozialen Probleme des eigenen Landes einem Perspektivwechsel unterzog und das einen wünschenswerten Impuls in Bezug auf die Wahrnehmung von Handlungsmöglichkeiten eigener Gesellschaften hinterließ. Ob es um eine gerechte soziale Fürsorge oder um Fragen des Umweltschutzes ging – spätestens seit den 1990er Jahren wurde Zivilgesellschaft für viele Parteien und Politiker in Westeuropa nicht nur zu einem wichtigen Erklärungsinstrument für den beispielhaften friedlichen Umbruch in Osteuropa, sondern auch zu einem wichtigen Kampfinstrument um Wählerstimmen und Bürgerbeteiligung.
Dabei spielten nicht nur die von osteuropäischen Oppositionellen geäußerte Kritik an der Steuerungsfähigkeit des autoritären Staates, sondern auch die weltweit zunehmenden Krisenerscheinungen des entwickelten Wohlfahrtsstaates eine wichtige Rolle. Insbesondere innerhalb der westeuropäischen Linken setzte ein konzeptionelles Umdenken ein, das die bürgerliche Gesellschaft, wie sie noch bei Marx begriffen wurde, aus ihrem negativ konnotierten Verständnis zu lösen und in ein neues Verhältnis zur Wirtschaft und zum Staat zu setzen begann. An die Stelle des Dualismus von bürgerlicher Gesellschaft und Staat trat der Tripartismus von Zivilgesellschaft, Staat und Markt, was im deutschen Neologismus „Zivilgesellschaft“ auch begrifflich nachvollzogen wurde. Die Konzeption einer assoziativen Demokratie, die als Fortentwicklung und Erweiterung der repräsentativen Demokratie gedacht und über freiwillige, selbstbestimmte gesellschaftliche Organisationen und eine Ausweitung der Bürgerbeteiligung verwirklicht werden sollte, bildete den Kern dieses Diskurses. Politische Initiativen, wie das aus der Idee des New Labour und der Agenda 2010 hervorgegangene Schröder-Blair-Papier zur Modernisierung der Europäischen Sozialdemokratie waren Teil ihrer – nicht unumstrittenen – Konsequenzen.
Trotz völlig unterschiedlicher Ausgangslagen vermochte die Vision einer aktiven Bürgergesellschaft damit einen Dialog zwischen Ost und West in Gang zu setzen, der bereits in den 1980er Jahren begann und bis heute andauern dürfte. Zu einem Zeitpunkt, als von politischer Entspannung zwischen Ost und West noch nicht die Rede war, hatte sie ein Diskussionsfeld eröffnet, innerhalb dessen ostmitteleuropäische Erfahrungen mit einem autoritären Regierungssystem und westeuropäische Überlegungen zur Zukunft des modernen demokratischen Wohlfahrtsstaates zusammenzufließen und sich gegenseitig zu beeinflussen begannen. Der Begriff der Zivilgesellschaft bündelte auf diese Weise den kleinsten gemeinsamen Nenner einer Schnittmenge an allgemein geteilten Interessen und Visionen in Bezug auf die Zukunft beider Teile Europas. Genau diese Schnittmenge und die über den Begriff gefundene gemeinsame Verständigungsbasis zwischen Ost und West bilden daher die bemerkenswerteste Leistung des Begriffes in und für Europa. An diese Errungenschaft anzuknüpfen und sie weiter auszubauen, sollte das wichtigste Ziel einer am Zusammenwachsen und -wirken Europas interessierten Öffentlichkeit sein. Die Frage, wie viel Zivilgesellschaft ein demokratischer Staat und wie viel Staat eine demokratische Zivilgesellschaft braucht, wird dabei jedoch vermutlich auch in Zukunft eines der vordringlichsten Aushandlungsfelder – und damit ein Anlass für Inspirationen, aber auch demokratische zu lösende Irritationen – europäischer Gesellschaften bleiben.
* Agnes Arndt, M.A. studierte Geschichte, Politikwissenschaft und internationales Recht an der Freien Universität und der Humboldt-Universität Berlin sowie an der Università degli Studi di Firenze. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und promoviert derzeit am Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas (BKVGE) mit einer Arbeit über die demokratische Opposition in Polen.
* * *
Die Deutschen und die sogenannte Polenhilfe 1980-1983
Seit Beginn der 1980er Jahre verdichteten sich in Westdeutschland die Hinweise auf eine sich anbahnende Versorgungskrise in Polen. Zahlreiche gesellschaftliche Gruppen und Privatleute begannen daraufhin, Lebensmitteltransporte nach Polen zu organisieren und private Hilfspakete mit der Post zu senden. So wurden allein im Jahr 1982 ca. 8,6 Millionen private Pakete versendet. In den Medien nahm das Thema unter dem heute leicht antiquiert klingenden Stichwort „Polenhilfe“ eine herausgehobene Stellung ein. Die Berichte konzentrierten sich oft auf den Aspekt der humanitären Hilfe, es gab aber auch Beiträge, die auf die Rolle der „Solidarność“ als Bedrohung für das gesamte kommunistische System hinwiesen und die Selbstverwaltungsstrukturen, die in Polen aufgebaut wurden, ausführlich beschrieben und würdigten.
Bei der Unterstützung der Polen in den 1980er Jahre handelte es sich überwiegend um ein Engagement der westdeutschen Zivilgesellschaft. Der größte Teil der Hilfsaktionen ging von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus (u. a. Caritas, Diakonie, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutsches Rotes Kreuz sowie zahlreiche kleine Initiativen, die sich extra zu diesem Zweck gründeten), während sich die Regierung der Bundesrepublik unter Bundeskanzler Helmut Schmidt mit Hilfslieferungen eher zurückhielt, sie wollte die guten Beziehungen zur polnischen Regierung nicht gefährden. Eine Ausnahme stellt die Gebührenbefreiung von Paketsendungen nach Polen dar, die auf Beschluss des deutschen Bundestags erfolgte und nahezu das ganze Jahr 1982 Geltung hatte.
Das Engagement aus Deutschland ist heute (in Deutschland, nicht jedoch in Polen) weitgehend vergessen, was vermutlich damit zusammenhängt, dass es sich – im Gegensatz zu einem zweiten positiven Ereignis der deutsch-polnischen Beziehungen des 20. Jahrhunderts, dem Kniefall Willy Brandts in Warschau 1970 – um keine staatliche Versöhnungsgeste, sondern „nur“ um bürgerschaftliches Engagement handelte.
Im Kontext der These Karl-Heinz Nussers, nach der bürgerschaftliches Engagement in den Ländern Westeuropas durch Impulse aus den mittel- und osteuropäischen Protestbewegungen wiederbelebt wurde, ist es interessant zu überprüfen, warum sich damals Deutsche für Polen engagierten. Waren sie tatsächlich vom bürgerschaftlichen Engagement der „Solidarność“ fasziniert und wollten es ihr gleichtun? Oder hatten sie vielleicht andere Gründe?
Für ein Projekt zur Dokumentation der „Polenhilfe“ haben wir einige Akteure überwiegend kleinerer privater Initiativen nach den Beweggründen für ihr Engagement befragt. Aus den Gesprächen ergibt sich, dass meist ein Bündel von Motiven eine Rolle spielte. Zum einen antworteten die meisten Befragten spontan, dass zunächst die ausführlichen Medienberichte über die schwierige Versorgungslage in Polen sie aufgerüttelt hätten und den ersten Anstoß dazu gaben, zu helfen. Ein langjähriger hauptamtlicher Mitarbeiter der Caritas ergänzte, es seien vor allem Bilder (insbesondere im Fernsehen) gewesen, die den Deutschen die dramatische Lage vor Augen führten und zu Spenden animierten. Darüber hinaus war es aber tatsächlich die Faszination für die „Solidarność“, die zum Helfen motivierte. So äußerte ein Interviewpartner, dass er vom Mut und Freiheitsdrang der Polen beeindruckt war und dass bei ihm auch ein gewisser Anti-Kommunismus eine Rolle gespielt habe. Andere fügten hinzu, sie hätten insbesondere die Auseinandersetzung der Kirche mit dem kommunistischen Regime bewundert – ein Engagement, das sie der katholischen Kirche nicht zugetraut hätten. Darüber hinaus hätten sie den Einsatz der „Solidarność“ auch als Weckruf verstanden, der in ihnen die Hoffnung erzeugte, dass der Kommunismus auch im anderen Teil Deutschlands überwunden werden könne. Bei Akteuren, die die Kriegszeit noch bewusst miterlebt hatten, spielten auch zwei weitere Motive eine Rolle. Einerseits hätte sie die eigene Hungererfahrung und das Bewusstsein, dass es ihnen heute so gut ginge, dazu gebracht, auf die Berichte aus Polen mit der Organisation von Lebensmitteltransporten zu reagieren. Andererseits – dieses Argument kam meist etwas zögerlich – spielte auch ein schlechtes Gewissen eine Rolle: Jetzt könne man wiedergutmachen, was die Deutschen einst den Polen angetan hätten.
Für den Zeitraum Anfang der 1980er Jahre scheint man also die These bestätigen zu können, dass die „Solidarność“ westliche Demokratien – zumindest die der alten Bundesrepublik – dazu inspiriert hat, neues bürgerschaftliches Engagement zu wagen. In diesem Fall erschloss sich die westdeutsche Zivilgesellschaft ein neues, bis dahin unbeachtetes Betätigungsfeld.
Es bleibt aber die unbeantwortete Frage, warum dieses Engagement heute in Deutschland weitgehend in Vergessenheit geraten ist und warum von der einstigen Solidarność-Begeisterung 30 Jahre später nicht viel übriggeblieben ist.
* Jutta Wiedmann ist Politikwissenschaftlerin. Sie bereitet eine Ausstellung zum Thema Hilfe der Deutschen für Polen zur Zeit des Kriegsrechts vor.
* * *
Feierlichkeiten, Rückblicke und sonst (fast) nichts
Nach der Lektüre des Textes von Karl-Heinz Nusser war ich entsetzt. Der Autor selbst, versteht sich, ist nicht daran schuld. Die Schuld tragen wir – die Polen. Den Text habe ich unglücklicherweise nach mehreren Stunden Indoktrination durch polnische Fernsehsendungen, die zum 30. Jahrestag der “Solidarität”-Bewegung ausgestrahlt wurden, gelesen. In den besagten Sendungen wurde selbstverständlich versucht, von dem “August 1980” zu erzählen. Solche Rückblicke auf dieses äußerst wichitge Ereignis sind häufig sehr vereinfacht und werden kaum in irgendeinen Kontext gesetzt.
Runde Jubiläen der “Solidarität”-Bewegung kamen immer schon zu ungünstigen Zeiten. Der 20. Jahrestag wurde zu sehr in unsere Bemühungen um den EU-Beitritt verwickelt, beim 25. kam dann der gescheiterte Versuch einer Nationalversöhnung anlässlich des Todes von Johannes Paul II. Diesmal ist das Jubiläum sogar noch mehr durch das Hier und Jetzt dominiert. Viele (womöglich, die meisten) Politiker und “Prominente”, die ab und zu beteuern, “der August” sei kein totes Denkmal, sehen ihn in Wirklichkeit genau so. “Der August” führte zur Wiederherstellung der polnischen Unabhängigkeit. Der Kampf um soziale Werte war nicht so gelungen – dies wird aber auch nur zeremoniell bemängelt.
Der Text von Karl-Heinz Nusser zeigt uns, wieviel mehr im Erbe der “Solidarität” steckt.
Wenn man in den 90er Jahren über das Erbe der “Solidarität” diskutierte, wurde regelmäßig auf die sozialen Konsequenzen der durch die “Solidarität”-Revolution in Gang gesetzten Veränderungen hingewiesen. Später wurde dieses Thema etwas vernachlässigt, heutzutage ist die Diskussion aber erneut sehr lebendig und nicht nur von dem unermüdlichen Ryszard Bugaj geführt. Die Erinnerung an Hunderttausende, die nach 1989 viele der damals erkämpften Rechte und Möglichkeiten nicht in Anspruch nehmen konnten, oder an die übertriebene Zurückhaltung beim Abbau der Privilegien, die die Stützen des kommunistischen Systems genossen haben, ist zwar erfreulich, macht jedoch immer noch keinen wesentlichen Unterschied…
Der August 1980 lebt weiter, nicht nur in Gedenkstätten, Jubiläumsmessen oder Andrzej Wajdas “Der Mensch aus Eisen”. Er lebt in Nichtregierungsorganisationen und in wahren Gewerkschaftlern, die sich von satten Bonzen nach dem Vorbild Jimmy Hoffas doch etwas unterscheiden. Er lebt auch in Menschen, die in irgendeinem Provinzloch um eine gute Sache kämpfen, weiter.
Die Kraft des “polnischen Augustes” lag in dem aufrichtigen Kampf für Ideale: den Patriotismus, die soziale Gerechtigkeit und die Achtung für den anderen Menschen. Diese Ideale sind zwar später gescheitert, aber es lohnt sich trotzdem immer, an sie zu erinnern. Heutige Probleme sind selbstverständlich ganz anders als die damaligen, die Botschaft der Bewegung von vor 30 Jahren ist jedoch wahrlich zeitlos.
* Łukasz Jasina ist Historiker und Publizist, Mitglied der „Kultura Liberalna“ Redaktion.
Übersetzung aus dem Polnischen: Wojciech Jakóbiec
* * *
Solidarność. Die Suche
Die Suche nach dem Phänomen der ersten „Solidarność“ erinnert an die bekannte Expedition der Kindheit auf der Suche nach einem vergrabenen Schatz auf einer Schatzinsel. Die Realität der Volksrepublik Polen ist das legendäre Land. Die Einzigartigkeit der NSZZ „Solidarność“ ist jedoch ein Juwel, nach dem man nicht so einfach greifen kann. Ganz im Gegenteil, es verlangt eine gewisse Mühe. Die mit Gold gefüllte Truhe ist normalerweise nur für die Historiker erreichbar. Das echte Gold sind jedoch alltägliche Dokumente: damalige Zeitungen, Appelle, Flugblätter und Artikel. Von jenen sprudelt außergewöhnliche Begeisterung aber auch Unruhe. Begeisterung der entdeckten Freiheit verbunden mit wahrer Angst, die mit der Frage „Werden die [Russen] reinkommen, oder nicht?“ beschrieben werden kann. Die Expedition zu diesen sechzehn Monaten und das Eintauchen in die damaligen Dokumente, ist eine reine Freude, Freude ungetrübt von späteren Analysen, politischen Ereignissen oder anderen dicken Filtern.
Es ist sofort zu sehen, dass der kostbare Mythos nicht nur aus Hoffnung, sondern auch aus Angst vor Intervention und – was man nicht vergessen darf – auch aus elementarer Armut konstruiert ist. Oft wird die Aufmerksamkeit nur den aus dem Zusammenhang gerissenen Vereinbarungen in Leninwerft, den damaligen Erwartungen und den späteren Grade der Realisierung, geschenkt. Im heutigem Kontext ist es nicht besonders von Nutzen, weil die Hoffnung der gesättigten Menschen in der Dritten Polnischen Republik eher andere Sachen betrifft. Wir haben heute andere Probleme. Es steht aber nichts im Weg, dass der „Solidarność“ Mythos uns begleiten könnte.
Obgleich der Tatsache, dass über den Prozess der Enttäuschung mit der ersten „Solidarność“ höchstwahrscheinlich eigene, ausführliche Studien geschrieben wurden, ist es interessant anlässlich des 30. Jahrestag des polnischen August einen ganz anderen Vorschlag zu machen.
Zunächst sollten die Polen, ebenso wie die Briten über ihre Königin, lernen über „Solidarność“ zu lachen. Der Mythos der ersten „Solidarność“ ist – wie Elisabeth II – ebenso unerlässlich wie anachronistisch. Während der 16 Monate verbindet der Mythos der „Solidarność“ die Vorstellungen über eine ideale Gemeinschaft mit den prosaischen Versuchen, das Ideal ins Leben zu rufen. Warum sollen wir nicht, wenn wir über die Jahre 1980 – 1981 berichten uns genauso verhalten, wie z.B. Janusz Głowacki, der genau in dieser Stimmung noch Anfang der 1980er Jahre den Roman „Ich kann nicht klagen“ geschrieben hat?
Weiter sollte man „Solidarność” von den Akteuren der damaligen Ereignisse, welche noch politisch tätig sind, wegnehmen. Ebenso wie junge Leute (die kein Glück hatten, über das Ende der Volksrepublik Polen im Geschichtsunterricht oder von Familienmitgliedern zu hören), schweben die in trüben Vorstellungen, die wie mit Klebstoff mit einer Sache verbunden sind: wahre Missachtung für „Solidarność”. Vergessenheit, Verfälschungen, Wirrwarr, sind keine Gründe für die Frustration. Wir sollen eher lernen, uns über die erste „Solidarność“ zu freuen, sowohl privat als auch auf der Ebene moderner Erziehung. „Solidarność” verdient unverzüglich ein Äquivalent des Museums des Warschauer Aufstands. Es ist tatsächlich möglich, jedem eine Chance zu geben und stolz auf die Zeitgeschichte Polens zu sein. Bis auf weiteres scheint der 31 August 1980 ein viel besserer Vorwand dafür zu sein als der 4 August 1989, da er weniger umstritten ist. Es ist auch interessant, dass wir das Buch, das den Mythos beschreibt, schon haben. Unwichtig ist, dass dieses Buch von einem Ausländer geschrieben wurde. Timothy Garton Ashs „The Polish Revolution: Solidarity, 1980–82“ bleibt eine unersetzbare Literatur (wenn irgendjemand fragen möchte – mit altem Ton – wie sollen wir über die „Solidarność” begeistert werden). Wenn wir Pflichtlektürenliste kürzen,vielleicht könnten wir dieses Buch darzustellen. Es ist schon eine Farce, dass die Politiker hartnäckig über diese Ereignisse streiten, während neue Generationen heranwachsen und ein durchschnittlicher Abiturient fast nichts über das Jahr 1980 weiß.
Warum sollten schließlich die letzten 21 Jahre nicht als eine große „August Vereinbarung“ verstanden werden? Die zeitweilige Illusion der Einheit wurde aus der Spaltung und dem Konflikt aus dem zweideutigen Verhältnis zur Vergangenheit geboren. Wir haben uns an der Freiheit verschluckt aber es folgte keine Idylle. Es wurde die ganze Zeit überlegt, wie viel es zu Tun gab. „Wir haben uns tatsächlich miteinander verständigt wie Pole mit Pole. Ohne Gewalt“ – sagte Lech Wałęsa am Ende des Streiks. Dasselbe gelingt bis auf weiteres auch heute.
* Jarosław Kuisz ist der Chef-Redakteur der „Kultura Liberalna”. Er hat letztens ein Buch über „Solidarność” veröffentlicht.
Übersetzung aus dem Polnischen: Käthe Pfaus und Karolina Wigura.
* * *
* Die Redaktion der „Kultura Liberalna“ bedankt sich bei Jutta Wiedmann für die Übersetzung des Textes von Krzysztof Ruchniewicz und für die Hilfe während der Redaktion der Ausgabe und bei Käthe Pfaus für die Hilfe bei der Übersetzung des Textes von Jarosław Kuisz.
** Author des Konzepts der Ausgabe: Jarosław Kuisz.
*** Author der Illustration: Rafał Kucharczuk.
„Kultura Liberalna” 86 (36/2010), 31 August 2010.